Zum 80. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz
Der 27. Januar 1945 ist ein für alle Zeit geschichtsträchtiges Datum. An jenem Tag erreichten Spitzen der vorpreschenden Roten Armee das deutsche Vernichtungslager Auschwitz und – so ist vielfach bekundet – fanden, ohne dass die Soldaten in irgendeiner Form darauf vorbereitet gewesen wären, einen Ort bis dahin wohl weithin für unmöglich gehaltenen Grauens vor. Jedwede Beschreibung hierzu ist an dieser Stelle nicht mehr erforderlich, zu allen denkbaren Details füllen die Forschungsergebnisse ganze Bibliotheken und existiert in den Medien heute ein unüberschaubarer Fundus gesammelten Wissens.
Gewiß, die Menschheitsgeschichte ist auch eine Geschichte unsäglicher Verbrechen und unvorstellbarer Grausamkeiten, sie ist – hier darf an ein Wort Klaus Theweleits erinnert werden – ebenso eine Geschichte des Schmerzes, den sich die Menschen zu allen Zeiten gegenseitig zufügten. Aber das Monströse, für das Auschwitz das ewige Synonym bleiben wird, das fabrikmäßige Morden von Menschen mit dem Ziel, vor allem die jüdische Bevölkerung überall dort, wo man ihrer habhaft werden konnte, zu töten, ausgeführt und geduldet von einem Volk, dessen Dichter und Denker einst Ruhm in der ganzen Welt genossen, ist als singuläres Ereignis untilgbar in das Menschheitsgedächtnis eingebrannt und das wird immer so bleiben.
Wie ist 80 Jahre später daran angemessen zu erinnern? Worauf soll sich unser Gedenken jetzt richten? Die Umstände heute sind mehr als schwierig. Als dem Europarat 2002 gelang, den 27. Januar zum Holocaustgedenktag zu bestimmen, schien noch alles einfach. Damals deklarierten die Initiatoren die Erinnerung an dieses unfassbare Verbrechen als sein Anliegen, ihn daneben aber auch zum Tag zur Verhinderung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Aber unsere Welt steht nicht still. Wenn uns etwa seit dem 7. Oktober 2023 die dramatischen Entwicklungen im Nahen Osten in Atem halten, dann ist hier vielfach von genau solchen Verbrechen gegen die Menschlichkeit die Rede – und zwar auf allen Seiten der kriegführenden Parteien. Diese Situation allein scheint bereits so wirkmächtig, dass das Erinnern an den Holocaust hierzulande vom tagespolitischen Geschäft, und dies ganz besonders in Zeiten des Wahlkampfes, erstickt zu werden droht. Fügt man dem noch die jüngsten Befragungsergebnisse hinzu, die abnehmendes Wissen über die Jahre der nationalsozialistischen Diktatur insbesondere in der heranwachsenden Generation belegen, wird umso deutlicher, dass der inzwischen allzuoft gehörte Appell, alles müsse getan werden, damit sich solch Geschehen nicht noch einmal ereigne, hier allein längst nicht ausreicht.
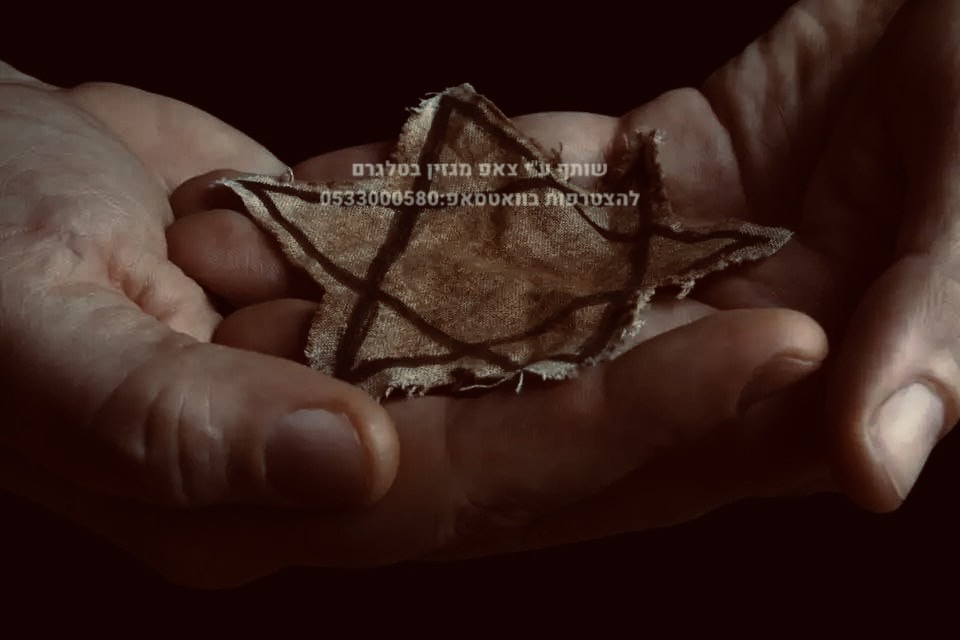
Quelle: Communities Plus
https://chat.whatsapp.com/HXy046Kj815GUCRl8f9Zpv
Denn tatsächlich geht es in diesem Gedenken um etwas anders. Weit mehr als die Erinnerung an dieses fürchterliche Verbrechen ist wachzuhalten – so sehr auch zu unterstützen ist, dass alle Details dazu erforscht, erfahrbar gemacht und bewahrt werden –, dass der Holocaust vor allem ein furchtbarer Bruch in den seit rund zwei Jahrtausenden bestehenden christlich-jüdischen Beziehungen war. Hier ist an einen Gedankengang Yehuda Bauers zu erinnern, der 1998 – gleichfalls am 27. Januar – im Deutschen Bundestag unterstrich, dass die europäische Kultur im Kern auf zwei Säulen beruhe: zum einen Athen und Rom, zum anderen Jerusalem. Griechisch-römische Literatur, Recht, Kunst und Philosophie wären über Jahrhunderte ebenso wirkmächtig wie die Propheten und die moralischen Gebote der hauptsächlich von Juden geschriebenen christlichen Bibel. Die Juden selbst waren bis in das 20. Jahrhundert hinein nie wirkliche Feinde von Deutschen oder Deutschlands, vielmehr wären deutsche Juden nicht selten darauf stolz darauf gewesen, was sie Gutes für die deutsche Zivilisation geleistet hätten. Aus gerade diesem Grund hätten sich die Nationalsozialisten mit ihrer Absicht, alle bestehenden Ordnungen zu liquidieren, um sich selbst schließlich zum Herrscher über die gesamte Welt erheben zu können, entschlossen, diese feste jüdische Wurzel der abendländischen Zivilisation unumkehrbar vernichten zu wollen.
Yehuda Bauer mahnte die Europäer, und dabei insbesondere die Deutschen: „Sich da des Holocaust zu erinnern ist nur ein erster Schritt. Ihn und alles, was im Zweiten Weltkrieg an Rassismus, Antisemitismus und Fremdenhaß geschah, zu lernen und zu lehren ist der nächste verantwortungsvolle Schritt. Bei diesem Schritt sind wir, Deutsche und Juden, voneinander abhängig. Ihr könnt die Erinnerungsarbeit nicht ohne uns bewältigen, und wir müssen uns sicher sein, dass hier, woher der Holocaust kam, eine alt-neue, humane, bessere Zivilisation auf den Trümmern der Vergangenheit entstanden ist. Wir zusammen haben eine ganz besondere Verantwortung gegenüber der gesamten Menschheit.“
Fast drei Jahrzehnte sind seit dieser Mahnung des unlängst verstorbenen großen Historikers vergangen. Angesichts der aktuellen Weltlage kann man den Gedanken nicht vollkommen unterdrücken, dass sich die Erfolge auf diesem Weg eher bescheiden ausnahmen. Und die Größe dieser Aufgabe ist, ebenfalls unverändert, kaum zu ermessen – aber zur Arbeit an ihr, Tag für Tag, gibt es keine Alternative.
Dr. Gerald Diesener
